Besucher

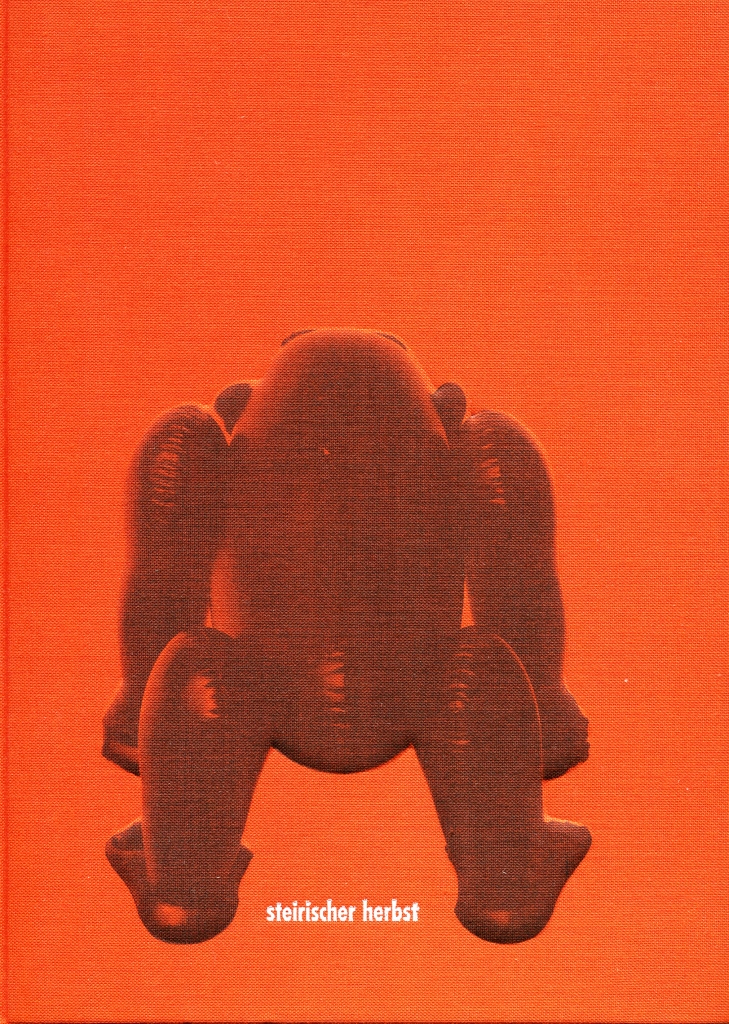

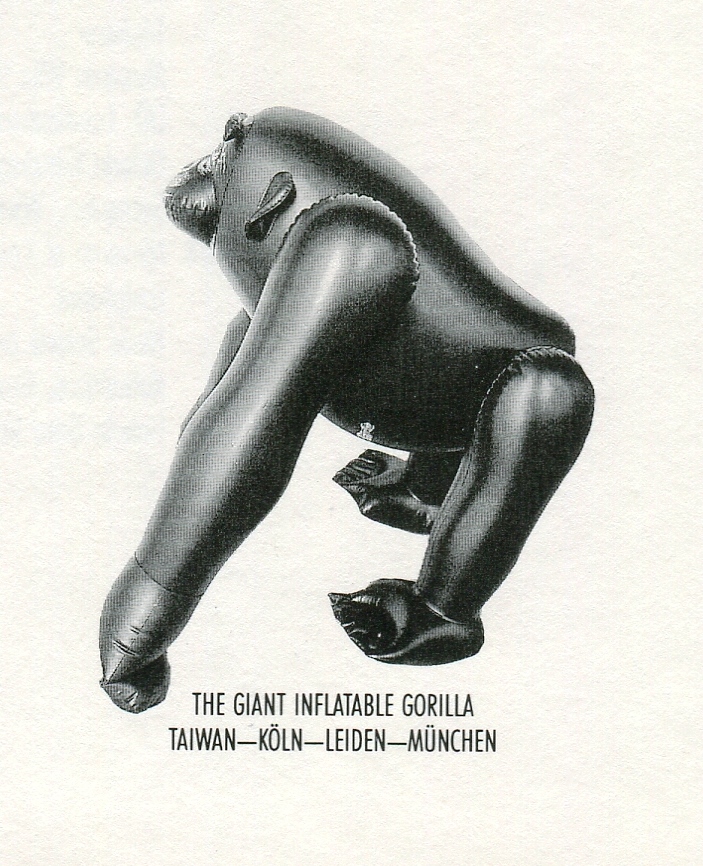
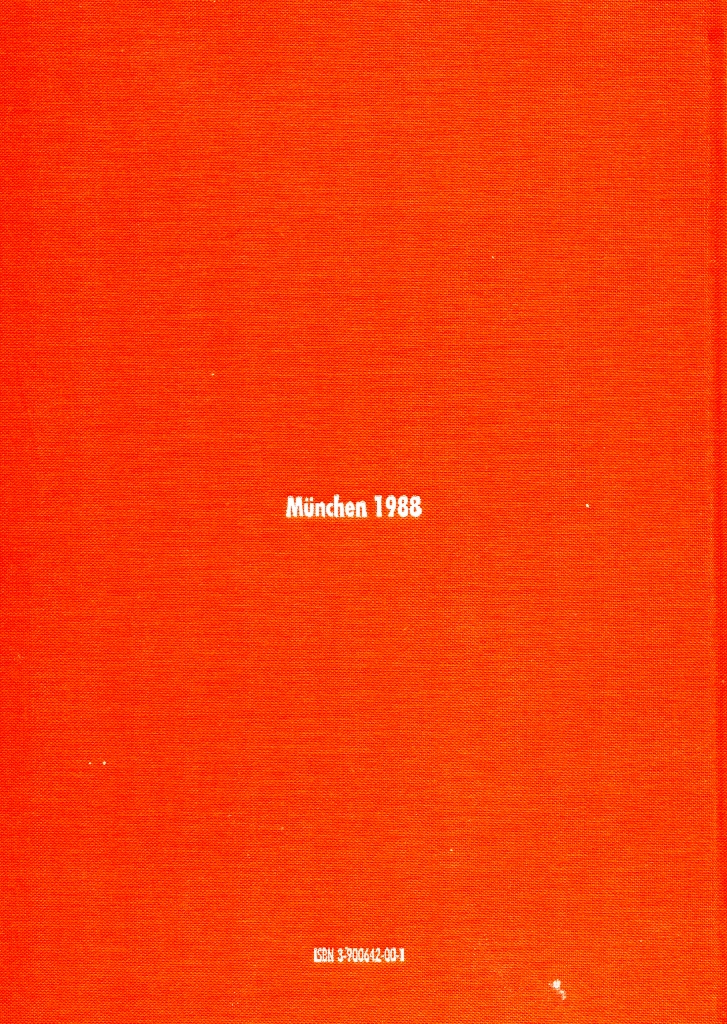






Konstruktionen und De-Konstruktionen des Alltags
Ein Roman ist nicht die Beichte eines Autors, sondern die Erforschung dessen, was das menschliche Leben bedeutet in der Falle, zu der die Welt geworden ist. (Milan Kundera)
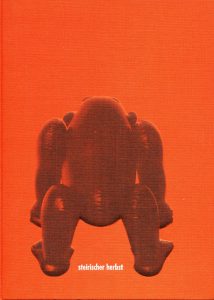
Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
Es ist geradewegs ein Glücksfall, daß die beiden Städte München und Graz keine Städtefreundschaft verbindet. Nur so, behaupte ich, konnte sich das Projekt eines Ausstellungsaustausches auf institutioneller Ebene – hie Kulturreferat, dort „steirischer herbst“ – in vernünftigen Bahnen entwickeln. Denn „Freundschaften“ und „Arbeitsgemeinschaften“ sind in nicht wenigen Fällen abgestorbene Zellen, die den lebendigen Organismus regionaler Kultureinheiten belasten. Auf diesen apostrophierten Kommunikationsebenen erfolgt sehr oft der Austausch von Inhalten, denen keine lokale Identität zukommt. Um überhaupt kulturelle Aktivitäten zu setzen, finden nur noch Repräsentationsveranstaltungen statt; die neu erschlossenen bzw. unter solchen Titeln reicher fließenden Geldquellen werden für Alibiaktionen verwendet; Konzepte, die sich nicht nur aus finanziellen, sondern meist aus altertümlichen oder falschen Strukturen heraus kaum am Leben halten konnten, feiern unter den Augen kommunikativ agierender Politiker ihre Auferstehung. Wenn auf diese Weise inszenierte Veranstaltungen nicht zumindest unter den Vorzeichen eines regionalen Selbstverständnisses, besser aber unter dem gemeinsamen Anliegen stehen, neue Fragen zu stellen, um darauf neue Antworten zu bekommen, entfällt in meinem Verständnis die unabdingbare Voraussetzung dafür, daß kulturelle Konfrontationen überhaupt einen Sinn besitzen. Das heißt, daß in den einzelnen in Frage kommenden Kommunen oder Regionen, die sich auf das Abenteuer kurz- oder längerfristiger gemeinsamer Aktionen einlassen, die Neugier am Unbekannten – auch wenn Thema oder Form vertraut erscheinen mögen – gefördert werden muß. Der Austausch bekannter Tatsachen scheint heute auch für ein tourismusorientiertes Kunstverständnis nicht mehr ausreichend. An dieser Neugier am Unbekannten hat in erster Linie die Kunst ihren gewichtigen Anteil. Sie sollte von ihrer unvergleichlichen kulturellen Position aus Fragen stellen und Antworten provozieren. Das funktioniert aber nur dann, wenn sowohl Kunstproduzenten als auch Kunstvermittler auf den jeweils gewachsenen Strukturen aufbauend an einer kontiuierlichen Weiterarbeit interessiert sind und sich nicht im Herzeigen einmal erreichter Leistungen üben, wenn das Neue, das gewagt wird, nicht kritiklos alte Muster kopiert.
Das soll im konkreten Fall heißen: die Vernetzung zweier Orte, die ohne Zwang Interesse an dem jeweils anderen Kulturbetrieb gefunden haben; das Hin- und Herschicken von Ergebnissen, die als Summe den Ausschnitt einer spezifischen Situation zu vermitteln imstande sind – bewußt gemacht als Ausschnitt, deklariert als Summe von Einzelteilen. Also weder das, was ein an internationaler Haltung geschultes Trendsettertum auf demoskopischer Basis als repräsentativ einstuft, noch der breite Querschnitt durch alle Lager und Generationen („seht her, wir haben von allem etwas“). Nicht der Internationalismus ist das Problem, sondern die provinzielle Haltung, die diesen als alleinige Meßlatte hernimmt. Nicht die Generationen sind das Faktum der Auseinandersetzung, sondern die Attitüde, einer „jungen Kunst“ nachzujagen. Böse Zungen könnten behaupten: Da wettert einer gegen dies und das, und dann hat er doch beides eingepackt, die Internationalen und die Jungen. Und sie hätten nicht unrecht mit dieser Behauptung. Nur: Nicht der Herzeigegestus hat sie zusammengeführt, sondern ihre Haltung, die Erfahrungswelt zu verlagern und damit das Kunststück in ein Koordinatensystem einzubringen, das sich von dem des „Irrationalismus der 80er Jahre“ wesentlich unterscheidet.
2
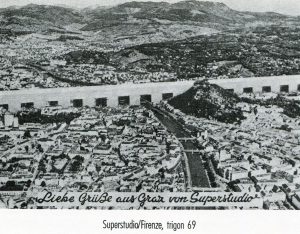
Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
Daß Graz nach wie vor die deutsche Literaturhauptstadt sei, hat Jürgen Laederach in einem Resümee über den „steirischen herbst ’86“ ernsthaft in Zweifel gezogen; daß die steirische Kapitale den Rang auf dem Gebiet der bildenden Kunst – wenigstens für Österreich – je besessen habe, stand nie ernsthaft zur Diskussion. Dennoch, diese Behauptung sei hiemit aufgestellt, unterscheidet sich das Grazer Kunstklima nicht nur wesentlich von jenem Wiens und der übrigen Landeshauptstädte, sondern strahlt von Zeit zu Zeit auf die künstlerische „Großwetterlage“ Österreichs aus. Eine Reihe von Konstellationen hat dazu geführt, von denen im Folgenden einige einer Interpretation unterzogen werden sollen. Im Gegensatz zu den nordöstlichen Landesteilen besitzt der Südosten Österreichs keine höhere Kunstschule. Die zaghaften Bemühungen, in Graz eine Akademie zu installieren, sind allesamt gescheitert. Einziger Ort künstlerischer Schulung ist bis heute die in den Künstlerbiografien euphemistisch als „Kunstgewerbeschule“ bezeichnete Anstalt geblieben. Offizieller Wortlaut: „Abteilung für bildnerisches Gestalten an der HTBLA Graz“.
Damit soll der Nachweis geführt werden, daß eine Anstalt mit ausdrücklich schulischer Struktur, an der sich heute eine Handvoll engagierter Künstler der normativen Schulpraxis unterwerfen muß, das Grazer Kunstinstitut ist. Die Mehrheit eines „harten Kerns“ sucht zur Weiterbildung die Akademie oder die Hochschule in Wien, eine Minderheit jene in Salzburg oder Linz bzw. im Ausland auf. Von kulturpolitischer Relevanz ist das Faktum, daß Graz zunächst mit dem „trigon“ (Biennale für bildende Kunst seit 1963) und dann mit dem „steirischen herbst“ (Österreichs Avantgardefestival auch nach 20 Jahren) zwei weit über den regionalen Raum hinaus wirksame, diesen aber durch die internationale Ausrichtung auch wesentlich befruchtende Veranstaltungsreihen aufzuweisen hat. Dabei darf man nicht vergessen, auf die öffentliche Institutionalisierung dieser jahreszeitlichen Schwerpunkte hinzuweisen. Das heißt, daß ehemals ein Direktorium, heute ein Intendant, im Falle des „steirischen herbst“ bzw. der Leiter einer Abteilung des Landesmuseums, nämlich der Neuen Galerie, im Falle des „trigon“ mit einem kleinen Stab von Konsulenten und Mitarbeitern die mehr oder weniger thematisch profilierte Ausrichtung der Veranstaltungen vornimmt.
Speziell aus der Tradition des „trigon“ heraus, das eigentlich in enger Verbindung mit der 1960 erfolgten Gründung der freien Künstlergruppe „Forum Stadtpark“ zu sehen ist und eine Gegenbewegung zu den nirgendwo in Österreich so eindeutig reaktionären Kunstübungen und
-rezeptionen der späten fünfziger und auch noch der sechziger Jahre markiert, verlagerte sich auch während des Jahres der programmatische Kunstbetrieb meistens ins Museum. Das war in jenen Phasen besonders evident, in denen dem Referat für bildende Kunst im „Forum Stadtpark“ die Ideen und auch das Geld ausgingen, da Literatur kontinuierlich an Gewicht zulegte und den Subventionstopf – vor allem durch die erfolgreiche Zeitschrift „manuskripte“ – nahezu allein leerte. Aber auch der künstlerische Niedergang der „Sezession“, des vierten der traditionellen Grazer Kunstvereine, der lange Zeit als einziger die Fahne der Gegenwartskunst mit einigem Erfolg hochgehalten hatte, war eine der Ursachen, daß der Avantgarde-Ball langsam, aber sicher endgültig ins Museum rollte. Die österreichweit registrierte geschickte Profilierung der Landesinstitution barg neben der positiven Seite auch die Gefahr der regionalen Vereinnahmung von Kunst in sich. Besonders klar und deutlich wurde diese Entwicklung am Beginn der achtziger Jahre: Die Transavantgarde-Bewegung und die mit ihr verknüpfte neuerliche Hinwendung zum Tafelbild schlug in den Ambitionen der Neuzeitabteilung des Museums deutlich zu Buche (die etwa gleichgelagerte städtische Einrichtung, das Kulturhaus, hat sich weitgehend der klassischen Moderne verschrieben).
Und plötzlich trat auch wieder ein bemerkenswertes Charakteristikum der Grazer Kunstlandschaft zutage, dessen Erwähnung bisher unterblieben ist: das Fehlen starker privater Kunstgalerien. So konnten auch nicht diese zu Trendsettern der steirischen Beiträge zur „internationalen Postmoderne“ werden. Das Museum sprang ambitioniert in die Bresche. Freilich büßte es durch dieses vorwärtsgaloppierende Engagement seine Rolle als integratives Forum des Zeitgeistes, seine Funktion als Korrektiv und als Ort der verarbeitenden Bestandsaufnahme in erheblichem Maße ein. Die Folge ist bis heute eine extreme Polarisierung. So suchen interessante malerische „Eigenbrötler“ oder Medien- und Performancekünstler das Museum nicht als Präsentationsort auf, wissend, sich gegen ein Einbahnsystem zu bewegen. Der auch unter diesen Umständen noch mögliche fruchtbare Dialog von außen muß sich in Grenzen halten: nicht zuletzt wegen unzureichend vorhandener weiterer Ausstellungs- und Aktionsmöglichkeiten. Sogar dem „herbst“ fehlen die entscheidenden Spielstätten. Die Hoffnungen in den neugegründeten „Grazer Kunstverein“ haben sich bisher ebenfalls nicht erfüllt. Seine Ausrichtung liegt weitgehend im internationalen Galeriekunst-Kontext . Auch wenn eben das Fehlen potenter Galerien beklagt wurde, in der Gestalt eines Kunstvereins kann dieses Manko nicht wettgemacht werden. Erst die Zukunft wird weisen, welche Bedeutung die Aktivitäten dieses mit einem nicht geringen Budget ausgestatteten Unternehmens für die Grazer Szene tatsächlich haben werden.
Doch kehren wir wieder zu den Künstlern selbst zurück. Die steirische „Standesvertretung“ (bVöST) zählt sicherlich zu den aktivsten im gesamten Bundesgebiet. Aus dem dringenden Bedürfnis heraus entstanden, die eigene Position vor allem auch in Hinblick auf die Gesellschaft zu definieren und einem neuen Wertkriterium zuzuführen, konnte eine Reihe von Vorhaben bereits verwirklicht werden: Vertretungen in den wichtigsten Juries des Landes und der Stadt, aber auch privater Preisstifter; in einem zähen Ringen eine schrittweise Anhebung der Zahl von Ateliers und Werkstätten für bildende Künstler und Kunsthandwerker; kontinuierliche Anstöße für einen Umdenkprozeß im Zusammenhang mit dem Umgang von Kunstwerken bei „Kunst am Bau“. Diese Aktivitäten greifen tief in die Kunstverwaltung und damit in den öffentlichen Raum ein. Ganz im Sinne dieser Öffnung sind auch die Projekte des Vereins „Steirische Kulturinitiative“ zu sehen, die, wie der der Name schon sagt, nur zu einem geringen Teil in der Landeshauptstadt selbst entwickelt werden. Dennoch ist eine Gruppe von Grazer Künstlern als Vordenker dieses bemerkenswerten Ansatzes anzusehen. Auf eine konkrete Umraumsituation bezogen, auf politische oder wirtschaftliche Gegebenheiten eingestellt, werden künstlerische Eingriffe in diesem klar abgesteckten Rahmen vorgenommen, gemeinsam mit Betroffenen oder für eine Beteiligung Gewonnenen. Eine Ideen- und Materialwerkstatt fern des elitären Kunstbetriebes: Bewußtseinsbildung aus künstlerischer (schöpferischer) Haltung heraus, meist unter dem Verzicht auf das traditionelle Artefakt. Hier, wie auch in der kreativen Handhabung der gegenwärtigen Computergeneration wird auf die Sprengkraft einer Kunst fern jedweder stilistischer Kriterien verwiesen.
3

Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
In der vorliegenden Auswahl richtet sich das Interesse auf die Möglichkeit und ihre Anwendungen, künstlerische Weltmodelle zu entwerfen. Damit ist nicht eine Rekonstruktion oder ein Wiederaufleben von Utopien der sechziger Jahre gemeint, ebensowenig wie die im vergangenen Jahrzehnt häufig angewendete Gleichung Kunst = Leben. Weltmodell – das ist nicht ein didaktisches Gebäude im Sandkastenspiel der Kunst. Eine solche inhaltliche wie visuelle Konstruktion vermag aber auch nicht durch den falsch interpretierten Begriff der „Gegenwelt“ charakterisiert zu werden. Denn die Konstrukte, um den Schluß vorwegzunehmen, sind nicht als Weltverweigerung im hortus conclusus der Ideen, Farben und Formen zu begreifen, sondern als Dialog mit den Eindrücken und Bildern vor und von der Welt. Wir können es als das Andere des Alltags bezeichnen, das aus dessen Repertoire gefügt wird. Oder als Neuinterpretation einer Objet-trouvé-Haltung, in der nicht die Netzhautreizung des Verworfenen, Abgebrauchten die dominierende Rolle spielt. Primär geht es um eine neue Benützbarkeit der gebrauchten Bilder, um eine Interpretation der Normen und Standards, um den Umgang mit täglich Erzeugtem, Verfügbarem. Kontakte in diese Richtung werden installiert, das Artefakt bleibt auf Tuchfühlung mit dem Lebensraum und wird zum nachvollziehbaren kulturellen Ereignis. Man kann fragen, welche Erlebnisqualität der Aha-Effekt, Bilder oder Gegenstände des Alltags in der Kunst wiederzufinden, besitzen kann.
Diese Frage gibt Gelegenheit, die ausgewählten Positionen näher zu bestimmen. Alle Realisationen, selbst die „Artlist“ Richard Kriesches, verbleiben im Kontext der Kunst. Mit anderen Worten, auch dort, wo Übertragungsmechanismen im Maßstab 1 : 1 Verwendung zu finden scheinen, bleibt die künstlich-künstlerische Ebene gewahrt, da es sich um De-Konstruktionen (Lothar Romain) der alltäglichen Realität handelt. Diese können nur paradigmatisch Gestalt erhalten und vom technokratisch-normativen Koordinatensystem befreit ihren Sinn beziehen. Wo anders als auf dem Feld der Kunst wäre dieser Befreiungs- und in weiterer Folge Erkenntnisakt möglich? Wo anders könnte er, wissenschaftlicher, soziologischer, politischer Strukturen entkleidet, über die ästhetische Leitung unmittelbar den Betrachter erreichen? Allerdings, diese Ästhetik flieht nicht die Zeichen, Signale oder Apparaturen der Umwelt, definiert sich nicht ausschließlich als Phantasmagorie eines Subjekts oder als Ausdruck der Seelenlandschaft. Der ästhetische output dieser Künstler – und das gilt mehr oder weniger für alle sechs Standpunkte – ist nicht eine Schöpfung aus dem Nichts (oder besser aus dem undefinierten Potential des Ich), sondern stellt Referenzen zur Alltagsästhetik her. Diese aber wird wiederum nur durch das „Kunstschöne“ sichtbar. Gegenüber der Postmoderne definiert sich diese Kunst dadurch, daß Reproduktionen und Auslösefaktoren sichtbar bleiben und nicht im Mythos des Spontanen (der in Wahrheit die verschleierte Verfügbarkeit der Geschichte ist) untertauchen.
4
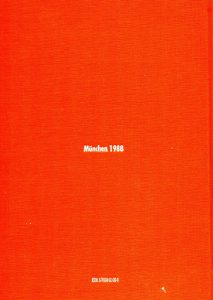
Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
Die einleitende Skizzierung der Grazer Kunstszene hat bereits deutlich gemacht, daß die Kunst in der Steiermark nicht ausschließlich durch jene Standpunkte charakterisiert ist, die hier in der Ausstellung vorgestellt werden. Also fiel die Entscheidung, an deren Endfassung mein Münchner Kollege Helmut Friedel mitgewirkt hat, aus Parteilichkeit, sofern man eine konzentrierte Auswahl vergleichbarer Positionen dafür halten will. Aus der Beobachtung von verschiedenen Möglichkeiten kristallisierte sich eine deutliche Tradition in Richtung Referenzen zur Alltagsästhetik heraus (Kriesche, Ertl, Temmel, Horáková & Maurer), sich überlappend mit künstlerischem Neubeginn (Anger, K. Schuster). Aber auch auf der Ebene der optischen Rezeption ergaben sich spannende Überlagerungen: Während sich Richard Kriesche im internationaen Medienbereich einen guten Namen gemacht hatte, erwarb sich Erwin Wurm seinen ebenfalls über Österreich hinausreichenden Ruf über den Kunstmarkt. Fedo Ertl und Wolfgang Temmel hatten mehrfach Arbeiten speziell auf den öffentlichen Raum abgestimmt, der ihnen mehr bedeutete als ein ins Freie verlagertes Museum. W. W. Anger und Klaus Schuster ermöglichten sich (und anderen) mit großem persönlichen Einsatz die Ausführung von Installationen in gemieteten alten Fabrikhallen.

Richard Kriesche, Artist 3. Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
„Kriesche goes to Pentagon“ war eine der Medienperformances des Künstlers, die er während seiner USA-Aufenthalte 1985 in Washington realisierte. Die Vernetzung der Bedeutungsebenen, die er besonders deutlich in den achtziger Jahren vornahm, kommt hier voll zum Tragen: Mit Leuchtstoffröhren auf dem Kopf, die die Umlaufbahnen von Satelliten auf ein pseudomenschliches Maß reduzieren, gleichzeitig aber das Hirn der höchsten technologischen Sphäre zuordnen, die heute und in Zukunft das Maß der Auseinandersetzungen bestimmen wird, akzentuiert er in einem (…goes to Pentagon) die charakteristische Ausrichtung der wichtigsten Weltsysteme. Künstliche Intelligenzen bestimmen unseren rationalen und emotionalen Habitus; die „wirkliche“ Reise um die Welt erfolgt längst nicht mehr mit dem Koffer in der Hand. Kriesche spricht sich als Künstler nicht von der gesellschaftspolitischen Verantwortung frei oder teilt sich ein künstlerisches und/oder politisches Individuum. „Artlist“ zeigt die Möglichkeiten von Konstrukten auf, die in diesem Zusammenhang nur der Kunst zur Verfügung stehen. Mit der Forderung nach „Konsequenzen“ thematisiert er die rationale Ebene, mit der gesamten Installation auch die emotionale. Das outfit der hardware zeigt seine ästhetisch konsequente Vorgangsweise.

Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
„Fish & chips“ sind für das Team TEER (Temmel/Ertl) ein weiteres Beispiel der Auseinandersetzung mit gut eingeführten Zeichensystemen. Waren es auf einer Fahne auf dem Grazer Schloßbergplatz die politischen und religiösen Machtzeichen, die als Lichtsymbole erschienen – vom Halbmond bis zum Hakenkreuz wurde unter dem Anspruch, das Heil in die Welt zu bringen, angetreten, – so gaukeln jetzt die Statussymbole der kaufbaren Welt in Form von Bronzegüssen internationaler Kreditkarten die jederzeitige Verfügbarkeit vor. Das romantische Blau, in die Jetztzeit der Swimmingpools transferiert, führt insistierend die bewußt eindimensionale Illusion der Ferienträume vor Augen. Das plakative Ambiente ist die formale Antwort auf die beharrliche, gezielte Verführung, auf das Leben aus dem Katalog.

Horáková & Maurer, Ein heißer Tag an einem der heißesten Orte der Welt. Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
Den Kontakt zu möglichen Erfahrungen der Alltagswelt hält auch die Installation von Horáková & Maurer in der Verpackung „Ein heißer Tag an einem der heißesten Orte der Welt“. Ein in seiner Dimension Reklametafeln angenähertes Bild und 32 kinetische Objekte setzen sich mit dem optischen Informationspotential auseinander. Die sich rasch verändernde Medienrealität der achtziger Jahre hat sie ebenso in den Bann gezogen wie die generellen Reflektionen über Bild, Bilder und Bildweiten. Die Trivialität von Sprach- und Bildmaterial wird fern jedes Zynismus oder jeder Ironie als beredte Input-lnformation verwendet. Die Veränderung von Material und Funktion bzw. die digitale Weiterverarbeitung von Zeichen bis zu deren Unkenntlichkeit (was die semantische Ebene betrifft) reizen in Verbindung mit der seriellen Wiederholung unser Auge aus. Soweit, daß das einzelne Objekt – oder der Schwarm von Objekten – als eigenständiges künstlerisches Faktum übrigbleibt. Beharrlich wird hier die Frage nach der Grenze von Kunst und Produktgestaltung gestellt – und beantwortet.

Erwin Wurm, Krieg der 50er mit den 60ern. Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
Auch Erwin Wurm bedient sich in seinem Ensemble „Krieg der 50er mit den 60ern“ vorgefundener Gegenstände. Im Gegensatz zu TEER und Horáková & Maurer transferiert er sie nicht in ein anderes Material. Das suggeriert uns klar und deutlich, daß er mehr an ihrem Habitus denn an ihrem „gesellschaftlichen Gebrauch“ interessiert ist. Hat Wurm noch vor wenigen Jahren hektisch an der Verwertbarkeit dieser abgelegten Gerätschaften für ein plastisches Gebilde gearbeitet, indem er quetschte, schweißte und malte, sind die Gegenstände heute im Gegensatz dazu fast unbearbeitet und wirken als monumentales oder surreales Design. Fast unbearbeitet, denn ein Bleiüberzug setzt sie doch ständigen Veränderungen aus. Wurms De-Konstruktionen wirken in diesem Konzept fast kulinarisch. Die Begründung für diese Feststellung ist im Kontextphänomen zu suchen, das sich notwendigerweise auf der Rezeptionsebene niederschlägt. Gerade dieses Ensemble setzt aber Markierungspunkte, die auch die anderen Arbeiten in ihrer spezifischen Erscheinung eingrenzen.

Klaus Schuster, Die Architektur einer Geschichte. Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
Nicht so knapp und streng, fast weniger präzise scheint Klaus Schuster mit seinen Belegstücken der alltäglichen Wirklichkeit – in Wahrheit die Realität genormten Aneignens der Vielfältigkeit von Gegenständen für (fast) alle Bedürfnisse – umzugehen. Runde und eckige, schmale und breite, harte und weiche Formen, die normalerweise in einen genau festgelegten, fast ritualisierten Kreislauf der Verwendung eingespannt sind, werden nun als „Architektur einer Geschichte“ in den ästhetischen Betrachtungsraum des Betrachters verspannt. Veränderte Zuordnung und raumbezogene Punktuationen verschieben die Erlebnisqualität in eine Richtung, in der weder die Koordinaten ehemaliger Verstrickungen in ein genau festgelegtes Regelsystem, noch die des minimalistischen Anspruchs von schöner, reiner Form über die neu entstandene Raumsituation gelegt werden können. Dieses mehrfache Ausbrechen aus Kreisläufen der Wahrnehmung charakterisiert die Arbeit.

W. W. Anger, Designstudie für ein Starwarprogramme oder die Leere dazwischen. Besucher, Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München 1988
Als ob er alles jederzeit für den häuslichen Gebrauch des Kunstsinnigen verfügbar machen könnte, entwickelt W. W. Anger seine „Designstudie für ein Starwarprogramm“. Das, was bei raschem Hinschauen vielleicht wie eine „Bastelei“ aus dem Fundus der Postmoderne aussehen mag, entpuppt sich doch als eine so runde Sache nicht. Zu unprätentiös wird Material mit Material kombiniert, die Gebilde in unterschiedliche Richtungen gespreizt und die reine Form der Skulptur durch Verspannungen oder unvermittelt akzentuierte Raumachsen verunklärt. Der Atompilz auf Eiche furniertem Sockel ist aus Gips, aber bronziert. Wenn die Ergebnisse höchster technologischer Kreativität zur Objektform „verkommen“, das gewaltigste vorhandene Energiepotential aus billiger Modelliermasse ersteht, dann scheint der Dialog auch mit der unvorstellbaren, dadurch aber umso realeren Wirklichkeit in das Stadium eines mehrfach gebrochenen Verhältnisses zu geraten. Anger thematisiert die Suggestionskraft von Kunst auf der einen, ihre Beschaulichkeit vor der Folie tatsächlicher Ereignisse auf der anderen Seite. Damit spricht er, wie die übrigen auch, an, daß Kunst als geistiges Phänomen der Ästhetik als Vehikel bedarf, um ihren Ausdruck zu finden. Dieser Tatsache sind sich die Künstler dieser Auswahl durchaus bewußt. Daher wissen sie, daß der Dialog mit den Erscheinungsformen des Alltags keine unmittelbaren Auswirkungen auf diesen hat, sie wissen aber auch, daß die Kunst als Modell anstelle des bloßen Scheins durchaus ein Instrument der Aufklärung im Sinne dialektische Weitsicht zu sein vermag, kein Frei-, sondern ein Resonanzraum für ein in unüberschaubaren Systemen erstarrendes Weltgebäude.

